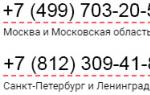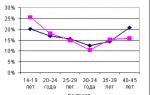Chemische Eigenschaften einfacher Substanzen von Metallen und Nichtmetallen. Chemische Eigenschaften von Metallen mit Beispielen
Reaktionsgleichungen für das Verhältnis von Metallen:
- a) zu einfachen Stoffen: Sauerstoff, Wasserstoff, Halogene, Schwefel, Stickstoff, Kohlenstoff;
- b) zu komplexen Stoffen: Wasser, Säuren, Laugen, Salze.
- Zu den Metallen gehören s-Elemente der Gruppen I und II, alle s-Elemente, p-Elemente der Gruppe III (außer Bor) sowie Zinn und Blei (Gruppe IV), Wismut (Gruppe V) und Polonium (Gruppe VI). Die meisten Metalle haben 1-3 Elektronen in ihrem äußeren Energieniveau. Für Atome von d-Elementen innerhalb der Perioden werden von links nach rechts die d-Unterebenen der Vor-Außenschicht gefüllt.
- Die chemischen Eigenschaften von Metallen beruhen auf der charakteristischen Struktur ihrer äußeren Elektronenhüllen.
Innerhalb eines Zeitraums nehmen mit zunehmender Ladung des Kerns die Radien von Atomen mit der gleichen Anzahl von Elektronenschalen ab. Alkalimetallatome haben die größten Radien. Je kleiner der Atomradius, desto größer die Ionisationsenergie, und je größer der Atomradius, desto geringer die Ionisationsenergie. Da Metallatome die größten Atomradien haben, zeichnen sie sich vor allem durch niedrige Werte der Ionisationsenergie und Elektronenaffinität aus. Freie Metalle weisen ausschließlich reduzierende Eigenschaften auf.
3) Metalle bilden Oxide, zum Beispiel:
Nur Alkali- und Erdalkalimetalle reagieren mit Wasserstoff unter Bildung von Hydriden:

Metalle reagieren mit Halogenen zu Halogeniden, mit Schwefel - Sulfiden, mit Stickstoff - Nitriden, mit Kohlenstoff - Carbiden.


Mit einer Erhöhung des algebraischen Werts des Standardelektrodenpotentials des Metalls E 0 in einer Reihe von Spannungen nimmt die Fähigkeit des Metalls ab, mit Wasser zu reagieren. Eisen reagiert also nur bei sehr hohen Temperaturen mit Wasser:

Metalle mit einem positiven Wert des Standardelektrodenpotentials, dh solche, die in einer Spannungsreihe hinter Wasserstoff stehen, reagieren nicht mit Wasser.
Typische Reaktionen von Metallen mit Säuren. Metalle mit einem negativen Wert von E 0 verdrängen Wasserstoff aus Lösungen von Hcl, H 2 S0 4, H 3 P0 4 usw.

Ein Metall mit niedrigerem E 0 -Wert verdrängt ein Metall mit höherem E 0 -Wert aus Salzlösungen:

Die wichtigsten industriell gewonnenen Calciumverbindungen, ihre chemischen Eigenschaften und Herstellungsverfahren.
Calciumoxid CaO wird Branntkalk genannt. Es wird durch Rösten von Kalkstein CaCO 3 --> CaO + CO bei einer Temperatur von 2000 ° C erhalten. Calciumoxid hat die Eigenschaften eines basischen Oxids:
a) reagiert mit Wasser unter Freisetzung großer Wärmemengen:
CaO + H 2 0 \u003d Ca (OH) 2 (gelöschter Kalk).
b) reagiert mit Säuren zu Salz und Wasser:
CaO + 2 HCl \u003d CaCl 2 + H 2 O
CaO + 2H + = Ca 2+ + H 2 O
c) reagiert mit Säureoxiden unter Bildung eines Salzes:
CaO + C0 2 \u003d CaC0 3
Calciumhydroxid Ca(OH) 2 wird in Form von gelöschtem Kalk, Kalkmilch und Kalkwasser verwendet.
Kalkmilch ist eine Suspension, die durch Mischen von überschüssigem gelöschtem Kalk mit Wasser entsteht.
Kalkwasser ist eine klare Lösung, die durch Filtrieren von Kalkmilch gewonnen wird. Wird im Labor zum Nachweis von Kohlenmonoxid (IV) verwendet.
Ca (OH) 2 + CO 2 \u003d CaCO 3 + H 2 O
Bei längerer Übertragung von Kohlenmonoxid (IV) wird die Lösung transparent, da ein wasserlösliches Säuresalz entsteht:
CaC0 3 + C0 2 + H 2 O \u003d Ca (HCO 3) 2
Wird die entstandene transparente Calciumbicarbonatlösung erhitzt, so tritt erneut eine Trübung auf, da CaCO 3 ausfällt.
WECHSELWIRKUNG VON METALLEN MIT NICHTMETALLEN
Nichtmetalle zeigen oxidierende Eigenschaften bei Reaktionen mit Metallen, nehmen Elektronen von ihnen auf und erholen sich.
Wechselwirkung mit Halogenen
Halogene (F 2, Cl 2, Br 2, I 2 ) sind starke Oxidationsmittel, daher interagieren alle Metalle unter normalen Bedingungen mit ihnen:
2Me+ n Hal 2 → 2 MeHal n
Das Produkt dieser Reaktion ist ein Metallhalogenidsalz ( MeF n -Fluorid, MeCl n -Chlorid, MeBr n -Bromid, MeI n -Jodid). Bei der Wechselwirkung mit einem Metall wird das Halogen auf die niedrigste Oxidationsstufe (-1) reduziert undngleich der Oxidationsstufe des Metalls.
Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt von der chemischen Aktivität des Metalls und des Halogens ab. Die oxidative Aktivität von Halogenen nimmt in der Gruppe von oben nach unten ab (von F bis I).
Wechselwirkung mit Sauerstoff
Sauerstoff oxidiert fast alle Metalle (außer Ag, Au, Pt ), was zur Bildung von Oxiden führt Ich 2 O n .
aktive Metalle unter normalen Bedingungen leicht mit Luftsauerstoff interagieren.
2 Mg + O 2 → 2 MgO (mit Blitz)
Metalle mit mittlerer Aktivität reagieren auch mit Sauerstoff bei gewöhnlicher Temperatur. Die Geschwindigkeit einer solchen Reaktion ist jedoch deutlich geringer als bei Beteiligung aktiver Metalle.
Inaktive Metalle beim Erhitzen durch Sauerstoff oxidiert (Verbrennung in Sauerstoff).
Oxide Die chemischen Eigenschaften von Metallen lassen sich in drei Gruppen einteilen:
1. Basische Oxide ( Na 2 O, CaO, Fe II O, Mn II O, Cu I O etc.) werden von Metallen in niedrigen Oxidationsstufen (+1, +2, in der Regel unter +4) gebildet. Basische Oxide interagieren mit sauren Oxiden und Säuren, um Salze zu bilden:
CaO + CO 2 → CaCO 3
CuO + H 2 SO 4 → CuSO 4 + H 2 O
2. Säureoxide ( Cr VI O 3 , Fe VI O 3 , Mn VI O 3 , Mn 2 VII O 7 etc.) werden von Metallen in hohen Oxidationsstufen (in der Regel über +4) gebildet. Saure Oxide interagieren mit basischen Oxiden und Basen, um Salze zu bilden:
FeO 3 + K 2 O → K 2 FeO 4
CrO 3 + 2KOH → K 2 CrO 4 + H 2 O
3. Amphotere Oxide ( BeO, Al 2 O 3, ZnO, SnO, MnO 2, Cr 2 O 3, PbO, PbO 2 usw.) haben eine duale Natur und können sowohl mit Säuren als auch mit Basen interagieren:
Cr 2 O 3 + 3H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4) + 3H 2 O
Cr 2 O 3 + 6 NaOH → 2 Na 3
Wechselwirkung mit Schwefel
Alle Metalle interagieren mit Schwefel (außer Au ), Salze bilden - Sulfide Ich 2 S n . Dabei wird Schwefel auf die Oxidationsstufe "-2" reduziert. Platin ( Pkt ) wechselwirkt mit Schwefel nur in fein verteiltem Zustand. Alkalimetalle und Ca und Mg reagieren mit Schwefel, wenn sie mit einer Explosion erhitzt werden. Zn, Al (Pulver) und Mg bei Reaktion mit Schwefel blitzt es auf. In Richtung von links nach rechts in der Aktivitätsreihe nimmt die Wechselwirkungsrate von Metallen mit Schwefel ab.
Wechselwirkung mit Wasserstoff
Mit Wasserstoff bilden einige aktive Metalle Verbindungen - Hydride:
2 Na + H 2 → 2 NaH
In diesen Verbindungen liegt Wasserstoff in seiner seltenen Oxidationsstufe "-1" vor.
E.A. Nudnova, M.V. Andrjuchowa
Die Struktur von Metallatomen bestimmt nicht nur die charakteristischen physikalischen Eigenschaften einfacher Substanzen - Metalle, sondern auch ihre allgemeinen chemischen Eigenschaften.
Bei einer großen Vielfalt sind alle chemischen Reaktionen von Metallen Redoxreaktionen und können nur von zwei Arten sein: Verbindungen und Substitutionen. Metalle sind in der Lage, bei chemischen Reaktionen Elektronen abzugeben, also Reduktionsmittel zu sein, um in den gebildeten Verbindungen nur eine positive Oxidationsstufe aufzuweisen.
Allgemein lässt sich dies durch das Schema ausdrücken:
Me 0 - ne → Me + n,
wo Me - Metall - eine einfache Substanz und Me 0 + n - Metall chemisches Element in der Verbindung.
Metalle können ihre Valenzelektronen an Nichtmetallatome, Wasserstoffionen und andere Metallionen abgeben und reagieren daher mit Nichtmetallen - einfachen Substanzen, Wasser, Säuren, Salzen. Das Reduktionsvermögen von Metallen ist jedoch unterschiedlich. Die Zusammensetzung der Reaktionsprodukte von Metallen mit verschiedenen Substanzen hängt auch von der Oxidationsfähigkeit der Substanzen und den Bedingungen ab, unter denen die Reaktion abläuft.
Bei hohen Temperaturen verbrennen die meisten Metalle in Sauerstoff:
2Mg + O 2 \u003d 2MgO
Nur Gold, Silber, Platin und einige andere Metalle oxidieren unter diesen Bedingungen nicht.
Viele Metalle reagieren mit Halogenen ohne Erhitzen. Zum Beispiel entzündet sich Aluminiumpulver, wenn es mit Brom gemischt wird:
2Al + 3Br 2 = 2AlBr 3
Wenn Metalle mit Wasser interagieren, werden manchmal Hydroxide gebildet. Alkalimetalle sowie Calcium, Strontium und Barium interagieren unter normalen Bedingungen sehr aktiv mit Wasser. Das allgemeine Schema dieser Reaktion sieht folgendermaßen aus:
Me + HOH → Me(OH) n + H 2
Andere Metalle reagieren beim Erhitzen mit Wasser: Magnesium beim Sieden, Eisen im Wasserdampf beim Rotkochen. In diesen Fällen werden Metalloxide erhalten.
Reagiert das Metall mit einer Säure, so ist es Teil des entstehenden Salzes. Wenn ein Metall mit sauren Lösungen in Wechselwirkung tritt, kann es durch die in dieser Lösung vorhandenen Wasserstoffionen oxidiert werden. Die abgekürzte Ionengleichung in allgemeiner Form kann wie folgt geschrieben werden:
Me + nH + → Me n + + H 2
Anionen solcher sauerstoffhaltiger Säuren, wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure, haben stärkere Oxidationseigenschaften als Wasserstoffionen. Daher reagieren solche Metalle, die nicht durch Wasserstoffionen oxidiert werden können, wie Kupfer und Silber, mit diesen Säuren.
Wenn Metalle mit Salzen interagieren, findet eine Substitutionsreaktion statt: Elektronen von den Atomen des substituierenden – aktiveren Metalls gehen zu den Ionen des substituierenden – weniger aktiven Metalls über. Dann ersetzt das Netzwerk Metall durch Metall in Salzen. Diese Reaktionen sind nicht umkehrbar: Wenn Metall A Metall B aus einer Salzlösung verdrängt, verdrängt Metall B Metall A nicht aus einer Salzlösung.
 In absteigender Reihenfolge der chemischen Aktivität, die sich in den Reaktionen der Verdrängung von Metallen voneinander aus wässrigen Lösungen ihrer Salze manifestiert, befinden sich Metalle in der elektrochemischen Spannungsreihe (Aktivität) von Metallen:
In absteigender Reihenfolge der chemischen Aktivität, die sich in den Reaktionen der Verdrängung von Metallen voneinander aus wässrigen Lösungen ihrer Salze manifestiert, befinden sich Metalle in der elektrochemischen Spannungsreihe (Aktivität) von Metallen:
Li → Rb → K → Ba → Sr → Ca → Na → Mg → Al → Mn → Zn → Cr → → Fe → Cd → Co → Ni → Sn → Pb → H → Sb → Bi → Cu → Hg → Ag → Pd → Pt → Au
Die links von dieser Reihe angeordneten Metalle sind aktiver und können die ihnen folgenden Metalle aus Salzlösungen verdrängen.
Wasserstoff ist in der elektrochemischen Spannungsreihe von Metallen enthalten, als einziges Nichtmetall, das eine gemeinsame Eigenschaft mit Metallen teilt - positiv geladene Ionen zu bilden. Daher ersetzt Wasserstoff einige Metalle in ihren Salzen und kann selbst durch viele Metalle in Säuren ersetzt werden, zum Beispiel:
Zn + 2 HCl \u003d ZnCl 2 + H 2 + Q
Metalle, die in der elektrochemischen Spannungsreihe bis zum Wasserstoff stehen, verdrängen es aus Lösungen vieler Säuren (Salzsäure, Schwefelsäure usw.), und alle nachfolgenden verdrängen z. B. Kupfer nicht.
blog.site, mit vollständigem oder teilweisem Kopieren des Materials, ist ein Link zur Quelle erforderlich.
Wenn wir im Periodensystem der Elemente von D. I. Mendeleev eine Diagonale von Beryllium zu Astat zeichnen, dann befinden sich auf der Diagonale unten links Metallelemente (sie enthalten auch Elemente sekundärer Untergruppen, blau hervorgehoben) und Nichtmetall Elemente oben rechts (gelb markiert). Elemente, die sich in der Nähe der Diagonale befinden - Halbmetalle oder Halbmetalle (B, Si, Ge, Sb usw.) haben einen doppelten Charakter (rosa hervorgehoben).
Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Elemente um Metalle.
Metalle sind ihrer chemischen Natur nach chemische Elemente, deren Atome Elektronen aus den äußeren oder voräußeren Energieebenen abgeben und so positiv geladene Ionen bilden.
Fast alle Metalle haben relativ große Radien und eine kleine Anzahl von Elektronen (von 1 bis 3) auf der äußeren Energieebene. Metalle zeichnen sich durch niedrige Elektronegativitätswerte und reduzierende Eigenschaften aus.
Die typischsten Metalle befinden sich zu Beginn der Periode (ab der zweiten), weiter von links nach rechts schwächen sich die metallischen Eigenschaften ab. In einer Gruppe von oben nach unten werden die metallischen Eigenschaften verstärkt, da der Radius der Atome zunimmt (aufgrund einer Zunahme der Anzahl von Energieniveaus). Dies führt zu einer Abnahme der Elektronegativität (der Fähigkeit, Elektronen anzuziehen) der Elemente und einer Zunahme der reduzierenden Eigenschaften (der Fähigkeit, bei chemischen Reaktionen Elektronen an andere Atome abzugeben).
typisch Metalle sind s-Elemente (Elemente der IA-Gruppe von Li bis Fr. Elemente der PA-Gruppe von Mg bis Ra). Die allgemeine elektronische Formel ihrer Atome ist ns 1-2. Sie sind durch die Oxidationsstufen + I bzw. + II gekennzeichnet.
Die geringe Anzahl von Elektronen (1–2) im äußeren Energieniveau typischer Metallatome legt nahe, dass diese Elektronen leicht verloren gehen und stark reduzierende Eigenschaften aufweisen, die niedrige Elektronegativitätswerte widerspiegeln. Dies impliziert die begrenzten chemischen Eigenschaften und Verfahren zur Gewinnung typischer Metalle.
Ein charakteristisches Merkmal typischer Metalle ist die Tendenz ihrer Atome, Kationen und ionische chemische Bindungen mit Nichtmetallatomen zu bilden. Verbindungen typischer Metalle mit Nichtmetallen sind Ionenkristalle „Metallkationen, Anionen von Nichtmetallen“, zB K + Br – , Ca 2+ O 2– . Typische Metallkationen sind auch in Verbindungen mit komplexen Anionen enthalten - Hydroxide und Salze, zum Beispiel Mg 2+ (OH -) 2, (Li +) 2CO 3 2-.
Die Metalle der Gruppe A, die die amphotere Diagonale im Be-Al-Ge-Sb-Po-Periodensystem bilden, sowie die ihnen benachbarten Metalle (Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi) weisen keine typischen metallischen Eigenschaften auf . Die allgemeine elektronische Formel ihrer Atome ns 2 np 0-4 impliziert eine größere Vielfalt an Oxidationsstufen, eine größere Fähigkeit, eigene Elektronen zu halten, eine allmähliche Abnahme ihrer Reduktionsfähigkeit und das Auftreten einer Oxidationsfähigkeit, insbesondere in hohen Oxidationsstufen (typische Beispiele sind die Verbindungen Tl III, Pb IV, Bi v ). Ein ähnliches chemisches Verhalten ist auch für die meisten (d-Elemente, also Elemente der B-Gruppen des Periodensystems (typische Beispiele sind die amphoteren Elemente Cr und Zn) charakteristisch.
Diese Manifestation von dualen (amphoteren) Eigenschaften, sowohl metallisch (basisch) als auch nichtmetallisch, ist auf die Natur der chemischen Bindung zurückzuführen. Verbindungen atypischer Metalle mit Nichtmetallen enthalten im festen Zustand überwiegend kovalente Bindungen (jedoch weniger stark als Bindungen zwischen Nichtmetallen). In Lösung werden diese Bindungen leicht aufgebrochen, und die Verbindungen dissoziieren (vollständig oder teilweise) in Ionen. Beispielsweise besteht Galliummetall aus Ga 2 -Molekülen, im festen Zustand enthalten Aluminium- und Quecksilber (II) -Chloride AlCl 3 und HgCl 2 stark kovalente Bindungen, aber in einer Lösung dissoziiert AlCl 3 fast vollständig und HgCl 2 - zu einem sehr kleinen Ausmaß (und dann in HgCl + und Cl - Ionen).
Allgemeine physikalische Eigenschaften von Metallen
Aufgrund des Vorhandenseins freier Elektronen ("Elektronengas") im Kristallgitter weisen alle Metalle folgende charakteristische allgemeine Eigenschaften auf:
1) Kunststoff- die Fähigkeit, die Form leicht zu ändern, sich zu einem Draht zu dehnen und zu dünnen Blättern zu rollen.
2) metallischer Schimmer und Opazität. Dies ist auf die Wechselwirkung freier Elektronen mit auf das Metall einfallendem Licht zurückzuführen.
3) Elektrische Leitfähigkeit. Sie wird durch die gerichtete Bewegung freier Elektronen vom Minus- zum Pluspol unter dem Einfluss einer kleinen Potentialdifferenz erklärt. Bei Erwärmung nimmt die elektrische Leitfähigkeit ab, weil. Mit steigender Temperatur nehmen die Schwingungen von Atomen und Ionen in den Knoten des Kristallgitters zu, was die gerichtete Bewegung des „Elektronengases“ erschwert.
4) Wärmeleitfähigkeit. Dies liegt an der hohen Beweglichkeit freier Elektronen, wodurch die Temperatur schnell durch die Masse des Metalls ausgeglichen wird. Die höchste Wärmeleitfähigkeit haben Wismut und Quecksilber.
5) Härte. Am härtesten ist Chrom (schneidet Glas); Die weichsten - Alkalimetalle - Kalium, Natrium, Rubidium und Cäsium - werden mit einem Messer geschnitten.
6) Dichte. Sie ist umso kleiner, je kleiner die Atommasse des Metalls und je größer der Radius des Atoms ist. Am leichtesten ist Lithium (ρ=0,53 g/cm3); das schwerste ist Osmium (ρ=22,6 g/cm3). Metalle mit einer Dichte von weniger als 5 g/cm3 gelten als „Leichtmetalle“.
7) Schmelz- und Siedepunkte. Das am leichtesten schmelzbare Metall ist Quecksilber (Schmp. = -39°C), das schwerste Metall ist Wolfram (T. = 3390°C). Metalle mit t°pl. über 1000°C gelten als feuerfest, darunter - niedriger Schmelzpunkt.
Allgemeine chemische Eigenschaften von Metallen
Starke Reduktionsmittel: Me 0 – nē → Me n +
Eine Reihe von Belastungen charakterisieren die vergleichbare Aktivität von Metallen bei Redoxreaktionen in wässrigen Lösungen. 
I. Reaktionen von Metallen mit Nichtmetallen
1) Mit Sauerstoff:
2Mg + O 2 → 2MgO
2) Mit Schwefel:
Hg + S → HgS
3) Mit Halogenen:
Ni + Cl 2 – t° → NiCl 2
4) Mit Stickstoff:
3Ca + N 2 – t° → Ca 3 N 2
5) Mit Phosphor:
3Ca + 2P – t° → Ca 3 P 2
6) Mit Wasserstoff (nur Alkali- und Erdalkalimetalle reagieren):
2Li + H2 → 2LiH
Ca + H 2 → CaH 2
II. Reaktionen von Metallen mit Säuren
1) Metalle, die in der elektrochemischen Spannungsreihe bis H stehen, reduzieren nicht oxidierende Säuren zu Wasserstoff:
Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2
2Al+ 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2
6Na + 2H 3 PO 4 → 2Na 3 PO 4 + 3H 2
2) Bei oxidierenden Säuren:
Bei der Wechselwirkung von Salpetersäure beliebiger Konzentration und konzentrierter Schwefelsäure mit Metallen Wasserstoff wird niemals freigesetzt! 
Zn + 2H 2 SO 4 (K) → ZnSO 4 + SO 2 + 2H 2 O
4Zn + 5H 2 SO 4(K) → 4ZnSO 4 + H 2 S + 4H 2 O
3Zn + 4H 2 SO 4 (K) → 3ZnSO 4 + S + 4H 2 O
2H 2 SO 4 (c) + Cu → Cu SO 4 + SO 2 + 2H 2 O
10HNO 3 + 4Mg → 4Mg(NO 3) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O
4HNO 3 (c) + Сu → Сu (NO 3) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O
III. Wechselwirkung von Metallen mit Wasser
1) Aktive (Alkali- und Erdalkalimetalle) bilden eine lösliche Base (Alkali) und Wasserstoff:
2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2
Ca+ 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2
2) Metalle mittlerer Aktivität werden durch Wasser beim Erhitzen zu Oxid oxidiert:
Zn + H 2 O – t° → ZnO + H 2
3) Inaktiv (Au, Ag, Pt) - reagieren nicht.
IV. Verdrängung von weniger aktiven Metallen durch aktivere Metalle aus Lösungen ihrer Salze:
Cu + HgCl 2 → Hg + CuCl 2
Fe+ CuSO 4 → Cu+ FeSO 4

In der Industrie werden oft nicht reine Metalle verwendet, sondern deren Mischungen - Legierungen bei dem die vorteilhaften Eigenschaften eines Metalls durch die vorteilhaften Eigenschaften eines anderen ergänzt werden. So hat Kupfer eine geringe Härte und ist für die Herstellung von Maschinenteilen wenig geeignet, während Legierungen von Kupfer mit Zink ( Messing) sind schon recht hart und im Maschinenbau weit verbreitet. Aluminium hat eine hohe Duktilität und ausreichende Leichtigkeit (geringe Dichte), ist aber zu weich. Auf seiner Basis wird eine Legierung mit Magnesium, Kupfer und Mangan hergestellt - Duraluminium (Duralumin), das, ohne die nützlichen Eigenschaften von Aluminium zu verlieren, eine hohe Härte erlangt und sich für die Flugzeugindustrie eignet. Legierungen von Eisen mit Kohlenstoff (und Zusätzen anderer Metalle) sind weithin bekannt Gusseisen und Stahl.
Metalle in freier Form sind Reduktionsmittel. Die Reaktivität einiger Metalle ist jedoch gering, da sie mit bedeckt sind Oberflächenoxidfilm, in unterschiedlichem Maße beständig gegen die Einwirkung von chemischen Reagenzien wie Wasser, Lösungen von Säuren und Laugen.
Beispielsweise ist Blei immer mit einem Oxidfilm bedeckt, sein Übergang in Lösung erfordert nicht nur die Einwirkung eines Reagenz (z. B. verdünnte Salpetersäure), sondern auch Erhitzen. Der Oxidfilm auf Aluminium verhindert dessen Reaktion mit Wasser, wird aber unter Einwirkung von Säuren und Laugen zerstört. Loser Oxidfilm (Rost), das an der Oberfläche von Eisen in feuchter Luft gebildet wird, stört die weitere Oxidation von Eisen nicht.
Unter dem Einfluss konzentriert Auf Metallen bilden sich Säuren nachhaltig Oxidfilm. Dieses Phänomen heißt Passivierung. Also konzentriert Schwefelsäure passiviert (und dann nicht mit Säure reagieren) solche Metalle wie Be, Bi, Co, Fe, Mg und Nb, und in konzentrierter Salpetersäure - Metalle A1, Be, Bi, Co, Cr, Fe, Nb, Ni, Pb , Th und U.
Bei der Wechselwirkung mit Oxidationsmitteln in sauren Lösungen verwandeln sich die meisten Metalle in Kationen, deren Ladung durch den stabilen Oxidationszustand eines bestimmten Elements in Verbindungen (Na +, Ca 2+, A1 3+, Fe 2+ und Fe 3) bestimmt wird +)
Die Reduktionsaktivität von Metallen in saurer Lösung wird durch eine Reihe von Spannungen übertragen. Die meisten Metalle werden in eine Lösung aus Salzsäure und verdünnter Schwefelsäure umgewandelt, aber Cu, Ag und Hg - nur Schwefelsäure (konzentriert) und Salpetersäure sowie Pt und Au - "Königswasser".
Korrosion von Metallen
Eine unerwünschte chemische Eigenschaft von Metallen ist ihre aktive Zerstörung (Oxidation) bei Kontakt mit Wasser und unter dem Einfluss von darin gelöstem Sauerstoff (Sauerstoffkorrosion). Beispielsweise ist die Korrosion von Eisenprodukten in Wasser weithin bekannt, wodurch sich Rost bildet und die Produkte zu Pulver zerfallen.
Die Korrosion von Metallen erfolgt in Wasser auch aufgrund des Vorhandenseins von gelösten CO 2 - und SO 2 -Gasen; es entsteht eine saure Umgebung und H + -Kationen werden durch aktive Metalle in Form von Wasserstoff H 2 ( Wasserstoffkorrosion).
Die Kontaktstelle zwischen zwei unterschiedlichen Metallen kann besonders korrosiv sein ( Kontaktkorrosion). Zwischen einem Metall wie Fe und einem anderen Metall wie Sn oder Cu, die in Wasser eingebracht werden, tritt ein galvanisches Paar auf. Der Elektronenfluss geht vom aktiveren Metall, das in der Spannungsreihe links liegt (Re), zum weniger aktiven Metall (Sn, Cu), und das aktivere Metall wird zerstört (korrodiert).
Aus diesem Grund rostet die verzinnte Oberfläche von Dosen (verzinntes Eisen), wenn sie in feuchter Atmosphäre gelagert und nachlässig behandelt werden (Eisen bricht schnell zusammen, nachdem selbst ein kleiner Kratzer sichtbar ist, wodurch Eisen mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt). Im Gegenteil, die verzinkte Oberfläche eines Eiseneimers rostet lange nicht, denn selbst bei Kratzern korrodiert nicht Eisen, sondern Zink (ein aktiveres Metall als Eisen).
Die Korrosionsbeständigkeit für ein bestimmtes Metall wird verbessert, wenn es mit einem aktiveren Metall beschichtet oder geschmolzen wird; Beispielsweise verhindert das Beschichten von Eisen mit Chrom oder das Herstellen einer Legierung von Eisen mit Chrom die Korrosion von Eisen. Verchromtes Eisen und chromhaltiger Stahl ( Edelstahl) haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Elektrometallurgie, d.h. Gewinnung von Metallen durch Elektrolyse von Schmelzen (für die aktivsten Metalle) oder Salzlösungen;
Pyrometallurgie, d. h. die Rückgewinnung von Metallen aus Erzen bei hoher Temperatur (z. B. die Herstellung von Eisen im Hochofenprozess);
Hydrometallurgie, d. h. die Isolierung von Metallen aus Lösungen ihrer Salze durch aktivere Metalle (z. B. die Herstellung von Kupfer aus einer CuSO 4 -Lösung durch Einwirkung von Zink, Eisen oder Aluminium).
Natürliche Metalle kommen manchmal in der Natur vor (typische Beispiele sind Ag, Au, Pt, Hg), aber häufiger liegen Metalle in Form von Verbindungen vor ( Metallerze). Durch die Verbreitung in der Erdkruste unterscheiden sich Metalle: von den häufigsten - Al, Na, Ca, Fe, Mg, K, Ti) bis zu den seltensten - Bi, In, Ag, Au, Pt, Re.
Unter Metallen versteht man eine Gruppe von Elementen, die in Form der einfachsten Substanzen vorliegt. Sie haben charakteristische Eigenschaften, nämlich hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstands, hohe Duktilität und metallischen Glanz.
Beachten Sie, dass von den 118 bisher entdeckten chemischen Elementen folgende Metalle enthalten sein sollten:
- aus der Gruppe der Erdalkalimetalle 6 Elemente;
- unter den Alkalimetallen 6 Elemente;
- unter den Übergangsmetallen 38;
- in der Gruppe der Leichtmetalle 11;
- unter den Halbmetallen 7 Elemente,
- 14 unter den Lanthanoiden und Lanthan,
- 14 in der Gruppe der Actiniden und Actinien,
- Außerhalb der Definition sind Beryllium und Magnesium.
Demnach gehören 96 Elemente zu Metallen. Schauen wir uns genauer an, womit Metalle reagieren. Da die meisten Metalle auf der externen elektronischen Ebene eine kleine Anzahl von Elektronen von 1 bis 3 haben, können sie in den meisten ihrer Reaktionen als Reduktionsmittel wirken (d.h. sie geben ihre Elektronen an andere Elemente ab).
Reaktionen mit den einfachsten Elementen
- Neben Gold und Platin reagieren absolut alle Metalle mit Sauerstoff. Beachten Sie auch, dass die Reaktion mit Silber bei hohen Temperaturen abläuft, aber bei normalen Temperaturen kein Silber(II)-oxid gebildet wird. Je nach Eigenschaften des Metalls entstehen durch die Reaktion mit Sauerstoff Oxide, Superoxide und Peroxide.
Hier sind Beispiele für jede der chemischen Formationen:
- Lithiumoxid - 4Li + O 2 \u003d 2Li 2 O;
- Kaliumsuperoxid - K + O 2 \u003d KO 2;
- Natriumperoxid - 2Na + O 2 \u003d Na 2 O 2.
Um Oxid aus Peroxid zu erhalten, muss es mit dem gleichen Metall reduziert werden. Zum Beispiel Na 2 O 2 + 2Na \u003d 2Na 2 O. Bei schwach aktiven und mittleren Metallen tritt eine ähnliche Reaktion nur beim Erhitzen auf, zum Beispiel: 3Fe + 2O 2 \u003d Fe 3 O 4.
- Metalle können nur mit aktiven Metallen mit Stickstoff reagieren, jedoch kann nur Lithium bei Raumtemperatur interagieren und Nitride bilden - 6Li + N 2 \u003d 2Li 3 N. Beim Erhitzen tritt jedoch eine solche chemische Reaktion auf 2Al + N 2 \u003d 2AlN , 3 Ca + N 2 = Ca 3 N 2 .
- Mit Ausnahme von Gold und Platin reagieren absolut alle Metalle sowohl mit Schwefel als auch mit Sauerstoff. Beachten Sie, dass Eisen nur beim Erhitzen mit Schwefel interagieren kann und ein Sulfid bildet: Fe+S=FeS
- Nur aktive Metalle können mit Wasserstoff reagieren. Dazu gehören Metalle der Gruppen IA und IIA, mit Ausnahme von Beryllium. Solche Reaktionen können nur beim Erhitzen unter Bildung von Hydriden durchgeführt werden.
Da die Oxidationsstufe von Wasserstoff als 1 betrachtet wird, wirken die Metalle in diesem Fall als Reduktionsmittel: 2Na + H 2 \u003d 2NaH.
- Die aktivsten Metalle reagieren auch mit Kohlenstoff. Als Ergebnis dieser Reaktion werden Acetylenide oder Methanide gebildet.
Überlegen Sie, welche Metalle mit Wasser reagieren und was ergeben sie als Ergebnis dieser Reaktion? Acetylene ergeben bei Wechselwirkung mit Wasser Acetylen, und Methan wird durch die Reaktion von Wasser mit Methaniden erhalten. Hier sind Beispiele für diese Reaktionen:
- Acetylen - 2Na + 2C \u003d Na 2 C 2;
- Methan - Na 2 C 2 + 2H 2 O \u003d 2NaOH + C 2 H 2.
Reaktion von Säuren mit Metallen
Auch Metalle mit Säuren können unterschiedlich reagieren. Bei allen Säuren reagieren nur solche Metalle, die in der Reihe der elektrochemischen Aktivität von Metallen zu Wasserstoff liegen.
Lassen Sie uns ein Beispiel für eine Substitutionsreaktion geben, die zeigt, womit Metalle reagieren. Auf andere Weise wird eine solche Reaktion als Redoxreaktion bezeichnet: Mg + 2 HCl \u003d MgCl 2 + H 2 ^.
Einige Säuren können auch mit Metallen interagieren, die hinter Wasserstoff her sind: Cu + 2H 2 SO 4 \u003d CuSO 4 + SO 2 ^ + 2H 2 O.
Beachten Sie, dass eine solche verdünnte Säure nach folgendem klassischen Schema mit einem Metall reagieren kann: Mg + H 2 SO 4 \u003d MgSO 4 + H 2 ^.